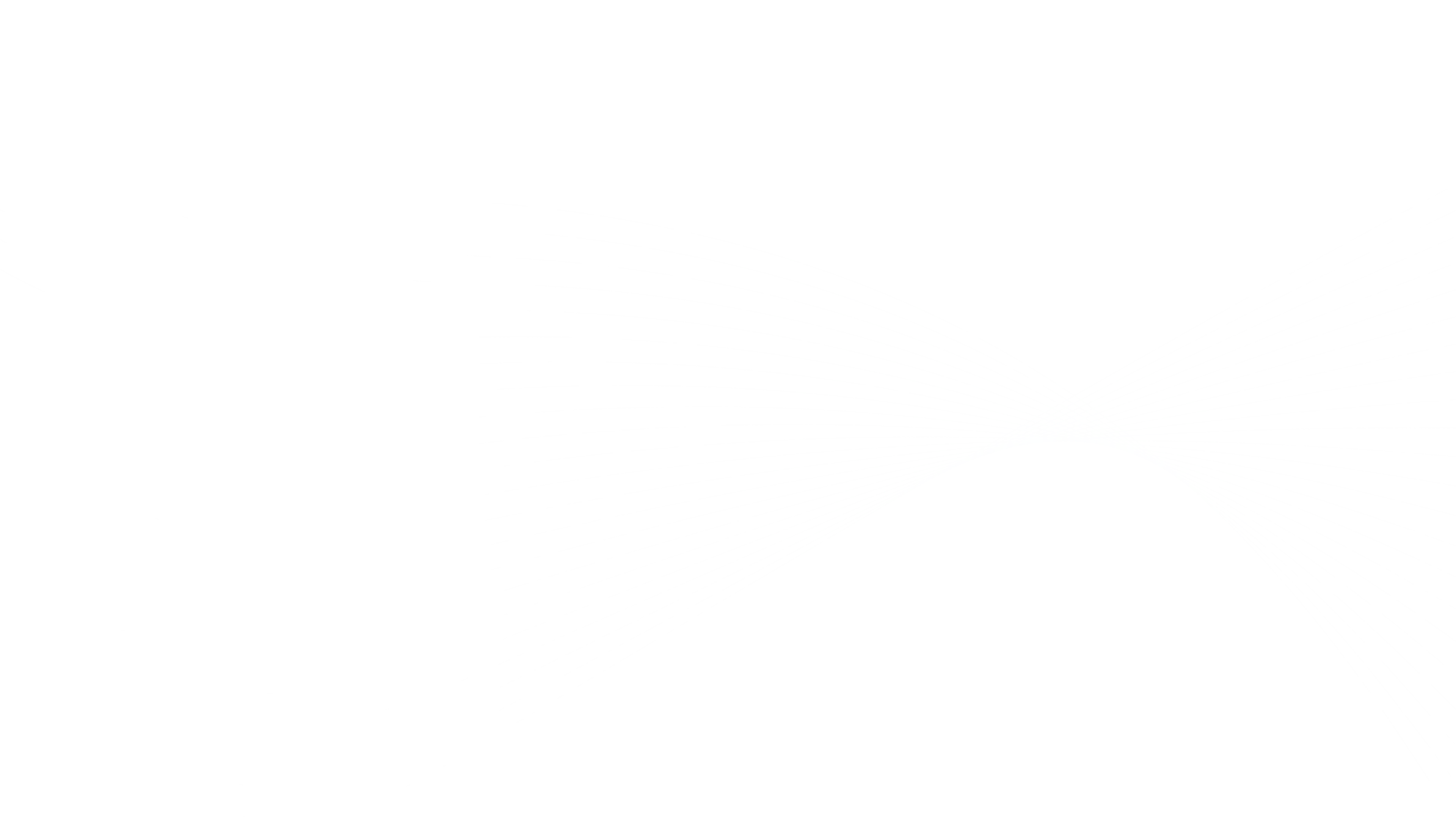
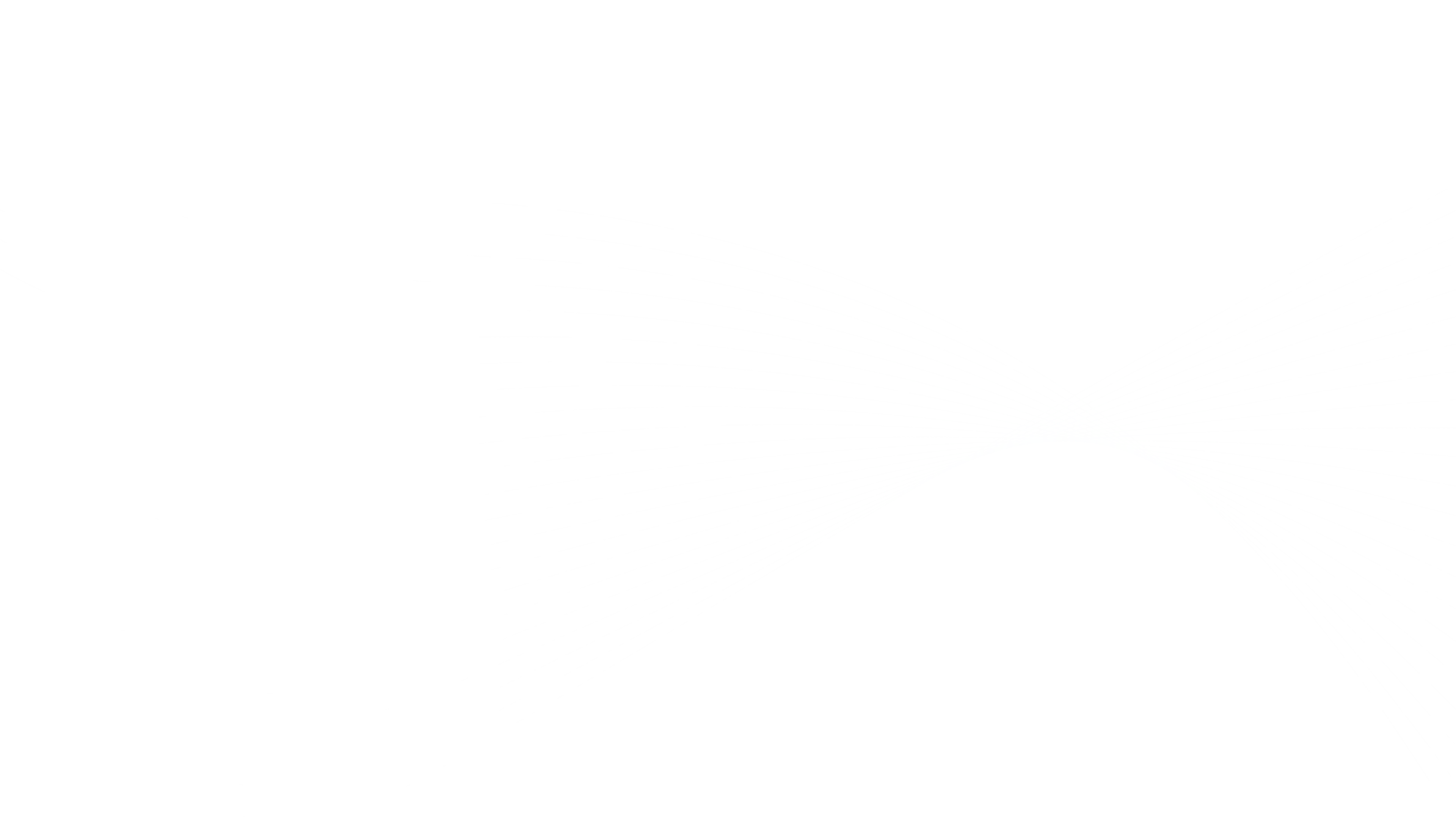

Lkw-Maut 2025: Zwischen Chance und Skepsis – was Fuhrparks jetzt realistisch prüfen sollten
In vielen Gesprächen mit Speditions- und Logistikunternehmen hören wir eine klare Zurückhaltung gegenüber E-Lkw: Vorteile bei CO₂-Bilanz, Zugang zu innerstädtischen Verkehren oder Imageeffekten stehen Bedenken gegenüber, die von Nutzlast und Reichweite über Ladefenster bis zu Restwerten und Infrastruktur reichen. Genau deshalb lohnt ein nüchterner Blick auf den regulatorischen Rahmen und darauf, welche Fragen Unternehmen 2025/26 wirklich klären sollten – ohne ideologische Scheuklappen und ohne ein pauschales „Ja“ oder „Nein“ zur Antriebswahl.
Rechtlich ist 2025 ein Übergangsjahr: Emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge sind bis einschließlich 31. Dezember 2025 von der Lkw-Maut befreit. Ab dem 1. Januar 2026 wird wieder Maut fällig, allerdings nur 25 Prozent des Infrastruktur-Teilsatzes zuzüglich der Anteile für Lärm und Luftschadstoffe; ein CO₂-Teilsatz fällt nicht an. Für besonders leichte, emissionsfreie Fahrzeuge bis 4,25 t gilt eine dauerhafte Befreiung. Diese Regelung setzt einen klaren Anreiz, muss aber in jedem Fuhrpark gegen operative Realität, Einsatzprofile und Finanzierungsfragen gehalten werden.
Parallel wurde die Mautpflicht bereits 2024 auf Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t ausgeweitet (mit Handwerkerausnahme in definierten Fällen). Für gewerbliche Transporte erhöht das den Anteil mautsensitiver Kilometer und damit die Relevanz einer sauberen Kapazitäts- und Tourenplanung – unabhängig vom Antrieb. Wer heute seine Relationen, Stoppmuster und Standzeiten strukturiert erfasst, kann die Mautlogik als Steuerungsgröße nutzen, statt sie nur hinzunehmen.
Wesentlich für die Kostenstellung ist die CO₂-Emissionsklasse des einzelnen Fahrzeugs. In Deutschland reicht die Skala von Klasse 1 (Auffangklasse) bis Klasse 5 (emissionsfrei). Fahrzeuge ohne belastbare Nachweise zur spezifischen CO₂-Emission werden zunächst der Klasse 1 zugeordnet; bessere Einstufungen setzen dokumentierte Hersteller- oder Zulassungsdaten voraus. Für die Praxis bedeutet das: Fahrzeugpapiere prüfen, Nachweise hinterlegen und die Einstufung intern eindeutig dokumentieren – denn formale Details entscheiden hier schnell über spürbare Beträge.
Aus betrieblicher Sicht ist 2025 deshalb weniger eine „E-Lkw-Entscheidung“ als eine Daten- und Prozessaufgabe: Flotten sollten zunächst ihr reales Einsatzprofil verstehen (Anteil Bundesfernstraßen, typische Umläufe, Ladefenster am Depot), ihre internen Datenflüsse ordnen (Stammdaten, Belege, Maut- und Energieinformationen) und technische Optionen gegeneinander testen – inklusive Szenarien, in denen der Umstieg verschoben wird. Für manche Unternehmen öffnet die befristete Mautbefreiung eine wirtschaftliche Tür, für andere bleiben Lade- und Prozessrisiken schwerer gewichtig. Beides ist legitim, solange die Entscheidung transparent hergeleitet wird.
Dabei lohnt es, den Informationsstand laufend zu aktualisieren. Tariftabellen, Einstufungshilfen und Verfahrenshinweise werden von BMDV, BALM und Toll Collect regelmäßig fortgeschrieben; wer Beschaffung, Disposition und Buchhaltung auf denselben Wissensstand bringt, vermeidet Reibungsverluste und teure Korrekturen. Gerade die saubere Abbildung der Emissionsklasse und die Dokumentation gegenüber Dienstleistern und Behörden sind keine Formsache, sondern Teil der Kostenkontrolle.
Unser Fazit bleibt bewusst offen: Die Lkw-Maut 2025/26 setzt spürbare Impulse, macht den E-Lkw aber weder automatisch zum Gewinner noch den Diesel per se obsolet. Wer nüchtern prüft, ob die eigenen Touren, Standzeiten und Energiepfade zum jeweiligen Fahrzeugkonzept passen – und wer die formalen Anforderungen im Griff hat –, wird zu einer tragfähigen Entscheidung kommen. Wir erleben in Deutschland viele Logistiker, die E-Lkw derzeit kritisch sehen; ebenso sehen wir Projekte, in denen der Einsatz im spezifischen Korridor sinnvoll ist. Beides kann richtig sein – entscheidend ist die Transparenz in der Herleitung.